08.01.24, 0:48
Fortführend möchte ich noch einen weiteren Aspekt adressieren und das ist die Aufnahmetechnik und das Mastering.
Früher wurde mit wenigen Mikrophonen quasi vor dem Orchestergraben aufgezeichnet. Da hatte man anfänglich ein Mikro mit nierenförmiger Aufnahmecharakteristik in der Mitte und je ein Mikro rechts und links, später kamen sog. Stützmikrophone dazu, welche Reflexionen des Raumes gegenphasig aufnahmen. Alle Signale wanderten an ein Mischpult, welche nur den Pegel des einzelnen aufgenommenen Signals regelte und der an der Aufnahme teilnehmende Tonmeister daraus dann ein realistisches Abbild der Aufnahmesituation auf Band bannte. Er konnte durch den A/-Vergleich jederzeit nachprüfen, ob er die Pegel der einzelnen Stimmen und Instrumente korrekt eingestellt hatte.
Ab den beginnenden Siebzigern führte man die sog. Multimikrophonierung ein und spendierte jedem Instrument des Orchesters/ der Ban ein eigenes Mikrophon oder einen elektrischen Abtaster. Die Signale wurden dann an das große Mischpult übertragen und dort einzeln aufgenommen und erst später in einem Regieraum von einem Tonmeister, der noch nicht einmal mehr den Aufnahmen beigewohnt haben musste abgemischt. Das ergab dann also kein realistisches Abbild der Aufnahmesituation mehr sondern stellt nur noch eine eine Interpretation derselben dar.
Wenn es nun beim Endprodukt um Räumlichkeit und Plastizität geht, dann wird diese bei diesen beiden Aufnahmeverfahren technisch gänzlich anders erstellt.
Bei der alten Methode beinhaltet das Musiksignal alle Informationen zu Position der Instrumente und dem Raum und das mit den realistischen Laufzeitunterschieden, weil die von einem auf der Bühne weiter hinten sitzenden Musiker einfach später am aufnehmenden Mikrophon angekommen sind. Diese Informationen liegen also laufzeit-, phasen und pegelkorrekt im Ausgangsmaterial bereits vor. Damit haben wir dann in dem von uns konsumierten Medium nicht nur ein 1:1 Abbild der realen Aufnahmesituation sondern auch und wenn wir es 1:1 so wie es auf dem Medium auch drauf ist und damit mit höchstmöglicher Wiedergabequalität und deshalb linearem Frequenzgang wiedergeben ein gesichertes Wiedergabeergebnis von der Quelle bis vor die Lautsprecher.
Bei Multimikrophonierung fehlt dem aufgezeichneten Kanal jegliche Rauminformation und diese wird von dem Tonmeister bei Mastering durch Kompression, Phasendrehung und Pegeländerung erst erzeugt. Da aber ebenfalls die Mitten sowie die Reflexionsaufzeichnung fehlt ist mittels dieser drei Hebel keine realistische Räumlichkeit mehr erzeugbar. Deshalb klingen derartig multimikrophonierte Aufnahmen auch teilweise so leblos bis flach oder auch manchmal räumlich irgendwie nicht stimmig.
Wenn wir also Klang bewerten, sollten wir also auch darüber nachdenken, wie das Musikstück überhaupt entstanden ist und welche unserer Erwartungshaltungen überhaupt erfüllt werden könnte bis kann und wie wir unser Bewertungsschema evtl. anpassen müssen, damit wir uns nicht von der Psychoakustik auf dem Arm nehmen lassen. Ebenso zeigt dieser Betrachtungswinkel auch sehr deutlich auf, welche Aufnahmen für eine Bewertung oder einen Vergleich überhaupt sinnvoll nutzbar sind.
Früher wurde mit wenigen Mikrophonen quasi vor dem Orchestergraben aufgezeichnet. Da hatte man anfänglich ein Mikro mit nierenförmiger Aufnahmecharakteristik in der Mitte und je ein Mikro rechts und links, später kamen sog. Stützmikrophone dazu, welche Reflexionen des Raumes gegenphasig aufnahmen. Alle Signale wanderten an ein Mischpult, welche nur den Pegel des einzelnen aufgenommenen Signals regelte und der an der Aufnahme teilnehmende Tonmeister daraus dann ein realistisches Abbild der Aufnahmesituation auf Band bannte. Er konnte durch den A/-Vergleich jederzeit nachprüfen, ob er die Pegel der einzelnen Stimmen und Instrumente korrekt eingestellt hatte.
Ab den beginnenden Siebzigern führte man die sog. Multimikrophonierung ein und spendierte jedem Instrument des Orchesters/ der Ban ein eigenes Mikrophon oder einen elektrischen Abtaster. Die Signale wurden dann an das große Mischpult übertragen und dort einzeln aufgenommen und erst später in einem Regieraum von einem Tonmeister, der noch nicht einmal mehr den Aufnahmen beigewohnt haben musste abgemischt. Das ergab dann also kein realistisches Abbild der Aufnahmesituation mehr sondern stellt nur noch eine eine Interpretation derselben dar.
Wenn es nun beim Endprodukt um Räumlichkeit und Plastizität geht, dann wird diese bei diesen beiden Aufnahmeverfahren technisch gänzlich anders erstellt.
Bei der alten Methode beinhaltet das Musiksignal alle Informationen zu Position der Instrumente und dem Raum und das mit den realistischen Laufzeitunterschieden, weil die von einem auf der Bühne weiter hinten sitzenden Musiker einfach später am aufnehmenden Mikrophon angekommen sind. Diese Informationen liegen also laufzeit-, phasen und pegelkorrekt im Ausgangsmaterial bereits vor. Damit haben wir dann in dem von uns konsumierten Medium nicht nur ein 1:1 Abbild der realen Aufnahmesituation sondern auch und wenn wir es 1:1 so wie es auf dem Medium auch drauf ist und damit mit höchstmöglicher Wiedergabequalität und deshalb linearem Frequenzgang wiedergeben ein gesichertes Wiedergabeergebnis von der Quelle bis vor die Lautsprecher.
Bei Multimikrophonierung fehlt dem aufgezeichneten Kanal jegliche Rauminformation und diese wird von dem Tonmeister bei Mastering durch Kompression, Phasendrehung und Pegeländerung erst erzeugt. Da aber ebenfalls die Mitten sowie die Reflexionsaufzeichnung fehlt ist mittels dieser drei Hebel keine realistische Räumlichkeit mehr erzeugbar. Deshalb klingen derartig multimikrophonierte Aufnahmen auch teilweise so leblos bis flach oder auch manchmal räumlich irgendwie nicht stimmig.
Wenn wir also Klang bewerten, sollten wir also auch darüber nachdenken, wie das Musikstück überhaupt entstanden ist und welche unserer Erwartungshaltungen überhaupt erfüllt werden könnte bis kann und wie wir unser Bewertungsschema evtl. anpassen müssen, damit wir uns nicht von der Psychoakustik auf dem Arm nehmen lassen. Ebenso zeigt dieser Betrachtungswinkel auch sehr deutlich auf, welche Aufnahmen für eine Bewertung oder einen Vergleich überhaupt sinnvoll nutzbar sind.
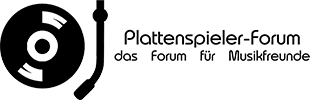

![[-]](https://plattenspieler-forum.de/images/collapse.png)